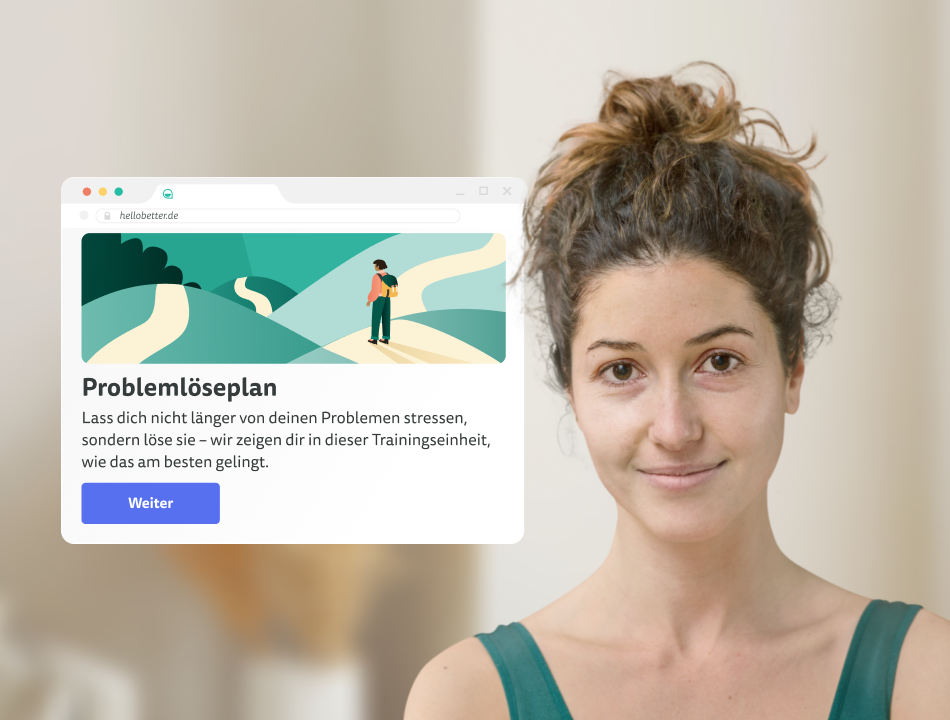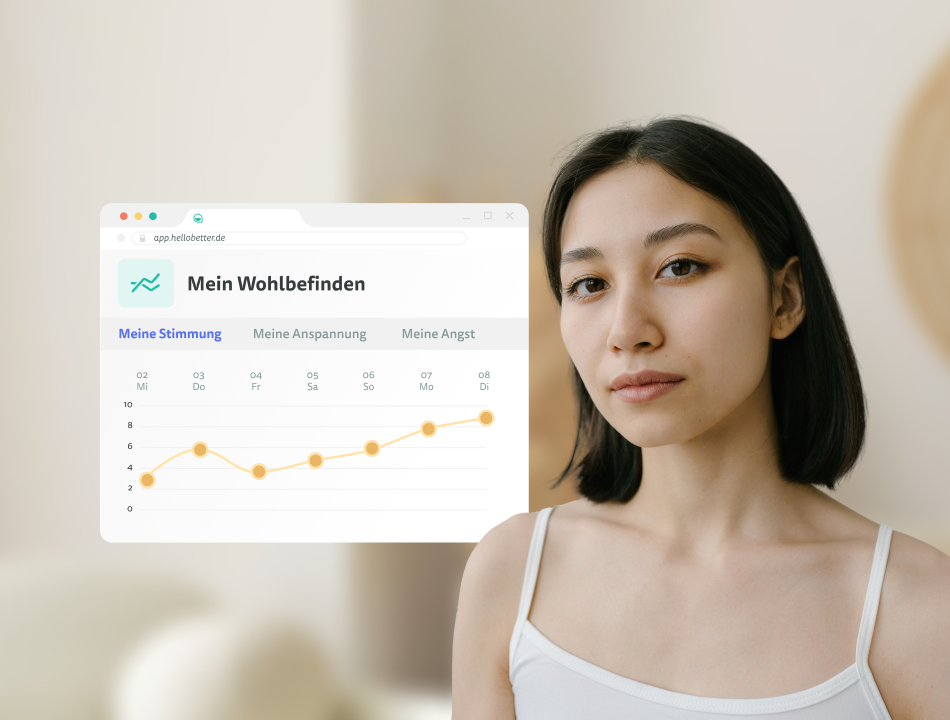Der Begriff postpartal bedeutet „nach der Geburt eines Kindes“ und bezieht sich auf die nachgeburtliche Zeit der Mutter. Die des Kindes beschreibt man als postnatal.
Was ist eigentlich das Wochenbett?
Als Wochenbett bezeichnet man die ersten sechs bis acht Wochen nach der Geburt eines Kindes. Genauer unterscheidet man dabei zwischen dem Frühwochenbett (Geburt bis 10. Tag) und dem Spätwochenbett (nachfolgende sechs bis acht Wochen). Diesen Zeitraum benötigt der weibliche Organismus in etwa zur Regeneration, Rückbildung und Erholung. Um das zu unterstützen, wird das Wochenbett daher idealerweise meist in und auf dem Bett verbracht und körperliche Aktivitäten deutlich reduziert. Darüber hinaus kann eine solche bewusste Gestaltung des Wochenbetts helfen, dass sich Eltern und Neugeborene in Ruhe kennenlernen und sich an die neue Familienkonstellation gewöhnen.
Es wird zwar empfohlen, sich für das Wochenbett ausreichend Zeit zu nehmen, ob und wie lange Eltern das tun, ist aber eine ganz persönliche Entscheidung.
Postpartales Stimmungstief: Was ist der Baby-Blues?
Depressive Verstimmungen während der Schwangerschaft oder nach der Geburt sind keine Seltenheit. So erlebt etwa die Hälfte aller Mütter in den ersten Tagen nach der Geburt einen Stimmungsabfall oder starke Stimmungsschwankungen. Betroffene nehmen sich zum Beispiel plötzlich als niedergeschlagen, ängstlich, unkonzentriert, erschöpft oder auch gereizt wahr. Dieses postpartale Stimmungstief (umgangssprachlich Baby-Blues) kann dabei sehr belastend sein, da es meist plötzlich und unerwartet eintritt.
Dabei ist ein solches Stimmungstief völlig normal. So gelten hormonelle Veränderungen wie der Abfall des Östrogenspiegels nach der Geburt eines Kindes als Hauptursache für den beschriebenen Stimmungseinbruch. Aber auch Stress und Schlafmangel können zur richtigen Belastung werden. Dabei gilt, dass der Baby-Blues meist einen leichten Verlauf nimmt und spontan innerhalb weniger Stunden oder Tage abklingt.
Wochenbettdepression: Beginn und Dauer
Bei der postpartalen Depression entwickeln Betroffene innerhalb der ersten 12 Monate nach der Geburt ihres Kindes depressive Symptome, die meistens wenige Monate, aber auch Jahre andauern können. Am häufigsten entwickeln sich Wochenbettdepressionen dabei schleichend und in den ersten drei Monaten nach der Geburt. Anders als der Name vermuten lässt, ist die Zeit des Wochenbetts also meistens schon vorbei. Trotzdem hat sich der Begriff Wochenbettdepression im deutschen Sprachgebrauch durchgesetzt.
Etwa 10 bis 15% aller Mütter entwickeln eine Wochenbettdepression. Dabei können auch Männer von einer postpartalen Depression betroffen sein – entweder als Folge oder unabhängig von der mütterlichen Wochenbettdepression.
Welche Symptome zeigen sich bei einer Wochenbettdepression?
Die Symptome einer Wochenbettdepression sind im Grunde die gleichen wie bei anderen Depressionen. Dazu zählen vor allem Niedergeschlagenheit, Interessenverlust, Antriebslosigkeit und eine erhöhte Ermüdbarkeit über einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen.
Bei der postpartalen Depression gibt es jedoch einige Besonderheiten. So steht die Symptomatik in einem klaren zeitlichen Zusammenhang zur Geburt des eigenen Kindes und ist inhaltlich geprägt von der Eltern-Kind-Beziehung sowie der Auseinandersetzung mit dem eigenen Elternsein.
Typische Symptome der Wochenbettdepression sind ein Gefühl der Gefühllosigkeit oder ambivalente Gefühle gegenüber dem Kind, Versagensängste, Schuldgefühle, Unfähigkeitserleben oder auch Stillprobleme. Es kann schwerfallen, sich dem eigenen Kind zuzuwenden oder Aufgaben wie Kinderarztbesuche wahrzunehmen. Einige Betroffene berichten zudem von sich aufdrängenden Gedanken, dem eigenen Kind etwas anzutun, was die Schuldgefühle zusätzlich verstärkt. Die eigentliche Freude über das Kind wird also von einer Gefühllosigkeit oder negativen Gefühlen überschattet, die scheinbar ohne Grund auftreten und anhalten können.
Wie wird eine Wochenbettdepression diagnostiziert?
Obwohl die postpartale Depression offiziell diagnostiziert werden kann, gibt es keine allgemein anerkannten Kriterien, nach denen das geschieht. In den meisten Fällen basiert die Diagnose also auf den Einschätzungen von Expertinnen und Experten sowie Betroffenen.
Darüber hinaus gibt es mit der Edinburgh-Postnatal-Depression-Skala (EPDS) einen speziell dafür entwickelten Fragebogen, der von den Betroffenen ausgefüllt wird. Das Ergebnis gibt Hinweise auf das Vorliegen einer Wochenbettdepression, die endgültige Diagnose kann jedoch nur in ärztlicher Absprache gestellt werden.
Risikofaktoren und Ursachen der postpartalen Depression
Schwangerschaften und Geburten gehen mit besonderen körperlichen und seelischen Herausforderungen einher, die zur echten Belastung werden können. Dazu gehört zum Beispiel eine oft veränderte, stressige Lebenssituation ohne ausreichend Schlaf. Bislang ist jedoch noch nicht ganz klar, welche genauen Ursachen zur Entwicklung einer Wochenbettdepression führen können. Es wird angenommen, dass ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren entscheidend ist. Hierzu zählen:
Biologische Risikofaktoren
- hormonelle Veränderungen (v.a. Östrogenabfall nach der Geburt)
- genetische Anfälligkeit für die Entwicklung von Depressionen
Psychische Risikofaktoren
- Depressive Verstimmungen in der Schwangerschaft
- Depressionen, Ängste, Panikattacken oder Zwangsstörungen in der Vorgeschichte
- belastende oder traumatische Erlebnisse in der Vorgeschichte
Soziale Risikofaktoren
- geringe soziale Unterstützung (z.B. durch die Familie)
- Konflikte (z.B. Stress in der Familie)
- belastende Lebenssituation (z.B. finanzielle Sorgen)
Wochenbettdepression: Behandlungsformen und Prognose
Die positive Nachricht zuerst: Die Prognose der Wochenbettdepression ist gut. In der Regel erholen sich die Betroffen vollständig. Dabei entscheidet meist der Schweregrad der Symptome, welche Behandlung – nach ärztlicher Absprache – individuell am hilfreichsten ist. So kann bei einer leichten Form der Wochenbettdepression oft schon eine praktische Unterstützung durch das soziale Umfeld hilfreich sein. Wenn Familienangehörige beispielsweise Kinderarztbesuche oder den Haushalt übernehmen, kann das für Betroffene bereits eine echte Entlastung bringen.
Wenn die postpartale Depression stärker ausgeprägt ist und/ oder länger andauert, kann eine psychotherapeutische Behandlung notwendig sein. Das kann ambulant in einer Praxis oder stationär in sogenannten Mutter-Kind-Kliniken beziehungsweise -Abteilungen erfolgen.
Dabei lernen Betroffene zum Beispiel, wie sie mit ihrem Kind in Kontakt treten und eine Bindung aufbauen können. In manchen Fällen kann zudem eine zusätzliche Unterstützung durch Medikamente (Antidepressiva) sinnvoll sein. Das sollte aber immer individuell mit der Hausärztin entschieden werden.
Darüber hinaus gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten der Selbsthilfe, mit denen Betroffene aktiv gegen ihre Wochenbettdepression vorgehen können. In unserem Artikel zum Thema Selbsthilfe bei Depressionen haben wir ein paar dieser Möglichkeiten zusammengefasst. Wir von HelloBetter haben außerdem den psychologische Online-Kurs Depression Prävention entwickelt, das depressive Beschwerden nachweislich verringern und den Phasen von Depressionen sogar vorbeugen kann. Der Kurs kann flexibel in den eigenen Alltag mit Baby integriert werden, sodass du selbstständig zu jeder Zeit darauf zugreifen kannst.
-
Hinweis zu inklusiver Sprache
Unser Ziel bei HelloBetter ist es, alle Menschen einzubeziehen und allen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich in unseren Inhalten wiederzufinden. Darum legen wir großen Wert auf eine inklusive Sprache. Wir nutzen weibliche, männliche und neutrale Formen und Formulierungen. Um eine möglichst bunte Vielfalt abzubilden, versuchen wir außerdem, in unserer Bildsprache eine große Diversität von Menschen zu zeigen.
Damit Interessierte unsere Artikel möglichst leicht über die Internetsuche finden können, verzichten wir aus technischen Gründen derzeit noch auf die Nutzung von Satzzeichen einer geschlechtersensiblen Sprache – wie z. B. den Genderdoppelpunkt oder das Gendersternchen.